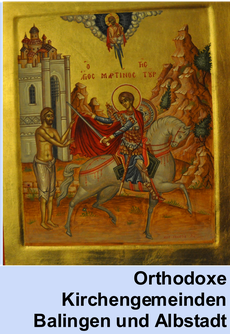Das Mysterion (Sakrament) der Heiligen Ölung
Hand-Out II zur Gemeindekatechese in Balingen am 09. April 2017
Thomas Zmija v. Gojan
Vorbemerkung: Die heilige Ölung oder die Krankensalbung ist das Mysterion (Sakrament), in dem die Heilige Kirche für einen Kranken die Gnade Gottes erfleht, welcher die Krankheiten der Seele und des Leibes durch Salbung mit geheiligten Öl heilt.
In unserer vor allem auf das diesseitige, irdische Leben bezogenen Lebenshaltung gibt es heutzutage fast niemanden, der richtig begreift, was Krankheit ist. Durch den Sündenfall kamen Leid, Krankheit und Tod in diese Welt. Sie sind nicht Teil der ursprünglichen Schöpfungsordnung Gottes, sondern eine Folge der Wirkmacht des Bösen. Seit dem Sündenfall sind es sein Einfluss, der die die Gesetze dieser gefallenen Welt bestimmt, in der die Sünde das Leben zerstört. Die unvermeidliche Folge der Sünde sind Krankheiten und Tod. Insofern ist sinnlos, den Körper heilen zu wollen, wenn die Seele weiterhin krank ist. Deshalb ruft die Kirche uns auf, wenn sie die körperlichen Nöte und Gebrechen heilen will, die Seele dabei nicht zu vergessen. Sogar wenn sich erfahrene Ärzte um unsere Gesundheit bemühen, schenkt allein Gott die Heilung, und wenn Er es in Seinem Heiligen und Unergründlichen Ratschluss es nicht will, werden alle Bemühungen und fachlichen Fähigkeiten der Ärzte am Ende umsonst sein. Aber der Herr hat die Macht, jeden Menschenm der Ihn voll Glauben bittet zu heilen. Diese Heilung wendet sich immer an den ganzen Menschen, sowohl seine Seele als auch seinen Körper.
Die orthodoxe Kirche will uns durch das Heilige Ölsakrament, die Heilige Krankensalbung, dorthin führen, dass, wenn wir uns anschicken, den menschlichen Körper zu heilen, nicht die Heilung der Seele vergessen. Deshalb wendet sie sich in diesem Mysterion der Heilung des Urgrundes aller Krankheit zu –der Sünde.
Im Buch der kirchlichen Gotttesdienste (Euchologion oder Trebnik (Rituale)) genannt steht geschrieben, dass dieses Sakrament den „schwer Erkranken“ gespendet wird. Da die orthodoxe Kirche die Sünde als eine Krankheit versteht und weit weniger als einen Regelverstoß gegen Gottes Gebot, der durch Rechtfertigung des Sünders vor Gott behoben wird, spendet die orthodoxe Kirche das Heilige Ölsakrament in der Großen und Heiligen Woche allen Gläubigen und nicht wie im Rest des Jahres nur den „schwer Erkranken“ (Dies sind die Regeln der russischen Tradition. Die Regeln der rumänischen und griechischen Tradition erlauben den Vollzug des Ölsakramentes für alle Gläubigen auch zu anderen Zeiten des Kirchenjahres).
Da der Empfang des Heiligen Ölsakramentes nicht nur zur Heilung des Leibes, sondern in erster Linie zur Heilung der Seele dient, hat die Heilige Kirche die Empfehlung oder Regel gegeben, dass der Empfang des Heiligen Ölsakramentes mit vorheriger Heiliger Beichte und Kommunion verbunden sein soll.
Wichtig zu beachten ist beim Empfang der Heiligen Krankensalbung, dass der Empfang des Sakramentes nicht bedeutet, dass man aufhören sollte, die verordneten Medikamente einzunehmen oder den Arzt aufzusuchen und seinen therapeutischen Anweisungen Folge zu leisten. Denn wenn die Heilung durch das Handeln des Arzt geschieht, so ist auch dies Gott Handeln durch die Hände des Arztes. Dies können wir in besonders schöner Weise am Leben des Heiligen Lukas von der Krim und dem der Heiligen Uneigennützigen erkennen. Erzbischof Gabriel sagte einmal, dass der heutige hohe Entwicklungstand der ärztlichen Kunst eine Erhörung der Gebete aller frommen Christen darstellt, die in den vergangenen Jahrhunderten um Heilung gebetet haben.
Der folgende Artikel behandelt das Heilige Ölsakrament mit einem besonderen Augenmerk auf seine Spendung am Mittwoch der Großen und Heiligen Woche (Karwoche). Zu einem späteren Zeitpunkt wird es auch einen eigenen Vortrag über das Heilige Ölsakrament und dem Umgang der Orthodoxie mit schwer Erkrankten und Sterbenden geben.
Die heilige Ölung ( griechisch: Ευχέλαιο, russisch: Соборование oder Елеосвящение) wird in der orthodoxen Kirche sowohl für die seelische Reinigung der Christen, als auch für die Kranken zu ihrer Stärkung und Heilung gespendet. Im Markus-Evangelium wird uns berichtet, wie die Apostel auf das Geheiß des Herrn zum Predigen hinaus zogen. Sie „trieben böse Geister aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund“ (Markus 6:13). Im Jakobusbrief steht: „Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Priester der Kirche, damit sie über ihn beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten; und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden“ (Jakobus 5: 14-15).
Über das Sakrament des Heiligen Öl sagt uns der heilige Symeon von Thessaloniki: "Das heilige Öl wurde uns überliefert als ein geheiligtes Sakrament und als eine Form der Göttlichen Barmherzigkeit, die den Empfängern gereicht wird zur Erlösung und Reinigung von den Sünden; deshalb entbindet dieses Sakrament von den Sünden, richtet von den Krankheiten auf und bewirkt die Heiligung. All dies wurde uns von unserem Gott Jesus Christus und durch Ihn von Seinen göttlichen Jüngern und Aposteln gegeben."
In vielen Gemeinden wird in der Heiligen und Hohen Woche, meist am Großen und Heiligen Mittwoch, das Mysterion des heiligen Öls für alle Gläubigen vollzogen, denn der Empfang der Heiligen Ölung soll der Gesundung der an Leib oder Seele Erkrankten dienen. Da die Sünde in der Orthodoxie nicht in erster Linie als ein Verstoß oder ein Rechtsbruch, sondern als eine am ende zum Tode führende Erkrankung verstanden wird, wird das Heilige Ölsakrament in der Karwoche für alle Gläubigen gespendet. Wie alle Mysterien der Heiligen Kirche dient die Heilige Ölung nicht allein der individuellen Seelentröstung, sondern ist wie die Feier aller Sakramente in der Orthodoxie in besonderer Weise gemeinschaftsbezogen, denn es wird in der Synaxis, der Versammlung der Kirche vollzogen.
Auch soll es, wenn möglich in der Synaxis der Priester vollzogen werden, denn der Gottesdienst soll, wenn möglich, von sieben Priestern zelebriert werden, gemäß den sieben Lesungen aus dem Apostel und dem heiligen Evangelium, den sieben Fürbittgebeten (Ektenien), den sieben Epiklesen, den sieben priesterlichen Gebeten und den sieben Salbungen, die aber der Einfachheit des Vollzuges halber (in der Regel kann das Sakrament in den Pfarrkirchen der Diaspora nur vom Gemeindepriester allein vollzogen) heute meist in einer Salbung am Ende des siebten Priestergebetes zusammengefasst werden. Diese Siebenzahl ist ein Hinweis auf die sieben Gaben des Heiligen Geistes (vgl.: Galater 5: 22), dessen Gnade durch die sieben Epiklesen das Ölivenöl des Sakramentes heiligt.
Über die Siebenzahl schreibt der Heilige Symeon: "Der Bruder des Herrn legte keine genaue Zahl von Presbytern für den Vollzug dieses Sakramentes fest (Jakobus 5:14), aber dem überlieferten Gebrauch zufolge werden sieben gerufen – ich denke wohl in Übereinstimmung mit der Siebenzahl an Geistesgaben, die bei Isaias (Jesaja) aufgezählt sind. Oder entsprechend jenen sieben alttestamentlichen Priestern, die auf das Geheiß Gottes siebenmal mit Posaunen um die Mauern von Jericho herumgingen und sie zerstörten. Oder damit die Priester (in Nachahmung des Propheten über dem Kind der Sunamitin) siebenmal um die Seele des Sterbenden beten und sie wieder zum Leben zu erwecken, so wie Elisäus den Knaben auferweckte, indem er sich siebenmal über ihn beugte und siebenmal betete. Oder damit sie wie Elias, welcher nach siebenmaligem Beten den Himmel wieder auftat, der wegen der Sünden verschlossen war, und Regen herabholte, die Dürre der Sünden aufheben, oder Petrus gleichsam den Himmel öffnen und mit dem Schlüssel der Gnade wie Regen die Gnade der Vergebung von Gott herabführen. Solches ist meiner Meinung nach der Sinn der Siebenzahl an Priestern. Aber einige rufen, wenn keine sieben vorhanden sind, im ganzen nur drei. Und das ist nicht ungebührlich wegen der Kraft der Allheiligen Dreieinheit, und auch in Erinnerung an das Zeugnis und die Verkündigung der Dreieinheit, die einst durch Elias erfolgte, als er den gestorbenen Sohn der Frau von Sarepta auferweckte, nachdem er dreimal gebetet und sich dreimal über ihn ausgestreckt hatte. Manche versammeln auch mehr als sieben Priester zum Ausdruck ihres größeren Glaubens und Eifers".
Des Weiteren wird zum Vollzug dieses Sakramentes nicht allein Olivenöl gebraucht. Auf dem Tisch vor der Ikonostas steht eine Schüssel mit Weizenkörnern. In deren Mitte befindet sich ein Gefäß, in das zu Beginn des Gottesdienstes Öl und Wein gegossen werden. Der Weizen versinnbildlicht die Frucht des Lebens (Markus 4: 1-20) und das Keimen des neuen Lebens aus dem Tode (vgl.: Johannes 12:24; 1 Korinther 15: 36-38). Das Olivenöl, das zur Salbung verwendet wird, weist auf die Heilungen von Kranken hin, die die heiligen Apostel durch Ölsalbung und unter Gebet erwirkten (vgl.: Markus 6:13). Der Wein, der beigemischt wird, symbolisiert das Blut Christi, durch das am Kreuz unsere Sünden geheilt wurden. Die Vermischung von Wein und Öl, symbolisiert die Heilung des unter die Räuber Gefallenen durch den Barmherzigen Samariter. Nach der Deutung der Heiligen Väter aber ist der Barmherzige Samariter aus dem Gleichnis unser Heiland Jesus Christus selbst, der das Öl und den Wein auf die, durch die Sünden verursachten, Wunden unserer Seele gießt (vgl.: Lukas 10:34).
Der Heilige Symeon sagt hierzu: "Und Öl wird in die Lampada oder in irgend ein anderes Gefäß gegossen, über dem sieben Kerzen gemäß der Zahl von sieben Priestern angezündet werden und zum Zeichen der Gaben des Heiligen Geistes, sowie zum Zeichen dessen, dass mittels des Heiligen Öls gleichsam die Göttliche Heiligung erfolgt, und dass Gott ein ganzes und ein reines Opfer dargebracht wird, damit wir fähig werden, Seine Gnade zu empfangen. Einhergehend damit versinnbildlicht es für uns auch die Heilung des Leibes des unter die Räuber Gefallenen, zu welchem ein Samariter hinging – Welcher der aus der Jungfrau Maria geborene Jesus ist – und Öl und Wein auf seine Wunden goß, das heißt ihn durch Sein Blut und Seine Barmherzigkeit heilte. Daher gießen einige den Wein vor dem Öl in das Gefäß."
Der Gottesdienst, in dem das Heilige Ölsakrament vollzogen wird besteht aus drei Teilen: Am Anfang steht ein Moleben (Paraklisis). Das Moleben ist ein kurzer Gebetsgottesdienst, der aus einem verkürzten Morgengottesdienst und einer Kanon-Hymne besteht. Der zweite Teil umfasst die Segnung des Öls und die Vermischung mit dem Wein. Dem folgt eine Erinnerung an die Gemeinschaft der Heiligen durch das Singen der Tropare: Der dritte Teil umfasst die Heiligung des Öls durch sieben Lesungen aus dem Apostel und dem heiligen Evangelium, sieben Fürbittgebete (Ektenien), sieben Epiklesen und sieben priesterliche Gebete. Dem folgt die Ölung selbst.
Im heiligen Myron ist das Olivenöl nur einer von vielen Bestandteilen, aber bei der Heiligen Ölsakrament stellt es die Hauptsubstanz zur Spendung des Sakramentes dar. Deshalb erbittet der Priester in der Epiklese: "Geheiligt werde dieses Öl durch die Gnade des Herrn..." Obwohl die Kirche zur Spendung der Heiligen Sakramente (der orthodoxe Sakramentsbegriff der Mysterien (Таинства) ist theologisch mit dem westkirchlich-abendländischen Begriff über das Wesen und Wirken der Sakramente nicht vollkommen deckungsgleich) einfache Substanzen wie Wasser, Öl und Myron verwendet, erhalten sie mittels das priesterliche Gebet der Epiklese die Kraft der Göttlichen Gnade. So sagt der Heilige Symeon: "Ich weiß, wie viele ungeheuer große Göttliche Gaben das heilige Öl in sich schließt: In ihm ist die Errettung von Krankheiten, der Nachlass der Sünden, und es schenkt Heiligung, Göttliche Stärkung und führt schließlich in das himmlische Königreich. Von den Wohlgesinnten möge keiner sprechen: "Das ist nur Öl, was kann ein aus einer Ölpflanze gewonnenes Material schon ausrichten?" Obwohl einfach, ist es doch von der Gnade erfüllt durch die Anrufung des Namens Gottes über ihm: Denn wo Gott angerufen wird, dort ist alles Göttlich und alles hat die Kraft Gottes.... Deshalb ist uns das Öl, das von den Priestern mittels der Anrufung Gottes geweiht wurde, göttlich und heilig, und von der Göttlichen Gnade des Heiligen Geistes erfüllt. Ähnlich wie auch das Taufwasser: Obwohl nur Wasser, ist es dennoch von Geist erfüllt, der die Seele reinigt, den Menschen aufbaut, ihn zum Kind Gottes werden lässt und ihn sündlos macht. Dem gewöhnlichen Wasser ist eigen, dass es körperliche Verschmutzungen reinigt und den Durst stillt; während es dem heiligen Wasser eigen ist, gleichzeitig mit dem Leib auch die Seele zu läutern, zu heiligen, neu zu schaffen, geistlich zu bewässern und zum Kind Gottes zu machen. In ähnlicher Weise strömt jedes gewöhnliche Myron nur Duft aus und erquickt die Sinne desjenigen, der es in Händen hält oder sich damit einreibt; aber das heilige Myron atmet Göttliches Leben, belebt uns besonders, erneuert uns im Geist, erfüllt uns mit dem Wohlgeruch Seiner Gaben und schenkt das Siegel und den Odem der Gnade – nicht als einfaches Myron, sondern als Heiliges Myron, das die Gnade des Heiligen Geistes besitzt, nachdem es geweiht wurde. So ist auch dieses Öl, das durch den Vollzug der heiligen Handlung geweiht wurde, ein heiliges und von Göttlicher Kraft erfülltes Öl".
Bei den Gebetstexten dieses Gottesdienstes fällt auf, das sie in Inhalt und Struktur weitgehend mit den Absolutionsgebeten im Mysteriums der Buße (Beichte) und mit den Kommunionsgebeten übereinstimmen. Wie in diesen, so wird auch in den Gebeten im Gottesdienst zur Spendung des Heiligen Ölsakramentes die Vergebung und Errettung aus Sündenschuld und Sündennot und die Verzeihung und der Nachlaß der Verfehlungen für die Versammelten erbeten.
Deshalb wird auch beim letzten Absolutionsgebet das Heilige Evangelium aufgeschlagen und mit der Schriftseite über die Häupter der Gläubigen gehalten wobei es von allen anwesenden Priestern gehalten wird. Hierbei sind zwei Aspekte besonders bemerkenswert: Erstens wird das Heilige Evangelium mit der Schrift nach unten über die Häupter der Anwesenden gehalten (eigentlich soll es auf die Häupter gelegt werden, was oft wegen der Menge der Versammelten nicht möglich ist), und zweitens halten alle Priester das heilige Evangelienbuch, das bedeutet, sie legen ihre Hände an es und damit auf die Häupter der Versammelten. Mit der ersten Handlung ahmt die Kirche das Beispiel des heiligen Propheten Elisäus nach, der bei der Auferweckung des Sohnes der Sunamitin zuerst seinen Stab schickte (2. Könige 4). Des weiteren bezeugt sie: So wie unser Herr Jesus Christus viele Wunder der Heilung an den Kranken vollbrachte, die im Buch des Heiligen Evangelium beschrieben sind, so ist das gleiche von Wundern erfüllte Evangelium auch hier jetzt gegenwärtig, um den Glauben der Anwesenden zu stärken, damit auch sie durch den Empfang des Heiligen Ölsakramentes eine ähnliche Heilung an Leib und Seele erfahren mögen.
Was das Auflegen der Hände der versammelten Priester betrifft, so ist der Priester beim Vollzug der Gottesdienste, vor allem aber bei dem der Sakramente, eine Ikone des eigentlich handelnden Liturgen Christus. So wie unser Herr Jesus Christus den Kranken Seine allmächtige Hand zur Heilung auflegte, so legen auch hier die Priester im Angesicht des an den Versammelten wirkenden Heilandes Jesus Christus als Seine Diener ihre Hände auf das Heilige Evangelienbuch oder halten es in ihren Händen. Und so wie Jesus Christus die Sünden der Ihn bittenden Kranken vergab und sie reinigte, so handelt Er auch jetzt an den versammelten Betenden und schenkt auch ihnen Vergebung und Heilung. Dies wird durch die Auflegung der Hände, als Zeichen der Versöhnung, als Zeichen diese Vergebung der Sünden veranschaulicht.
Der Heilige Symeon sagt dazu: "Indem der Priester die Hand auf das Haupt des Reumütigen legt, spricht er ein Gebet und zeigt dadurch, dass er eine heilende Handlung vollzieht in Nachahmung des Herrn, Welcher den Gebrechlichen die Hände auflegte und sie durch Berührung heilte, und dass er, der selbst durch Handauflegung geweiht wurde und durch Auflegung der Hände sein Priesteramt versieht, die Gläubigen mittels dieser sichtbaren Handlung durch die Gnade Gottes reinigt und heiligt".
Gemäß der Heilung des Gelähmten (Matthäus 9:1-8; Markus 2:1-12) - die im sechsten der priesterlichen Absolutionsgebete erwähnt wird - dem der Herr zuerst die Vergebung der Sünden erteilte, ehe Er seine körperlichen Leiden heilte, sind es nicht unsere körperlichen oder seelischen Leiden, die das eigentliche Grundübel unserer menschlichen Existenz ausmachen und von dem wir in erster Linie Befreiung suchen und erbitten sollten, sondern von unserer irdischen Verhaftung an unsere Sünden, von unserer Hartherzigkeit und von unserer Gebundenheit (Verhaftung) an verderbliche Leidenschaften. So wird das Heilige Ölsakrament in der Großen und Heiligen Woche allen orthodoxen Gläubigen zur Heilung von ihren, in der orthodoxen Kirche als Krankheit verstanden, Bindungen an die Sünden gespendet. Unsere einzelnen Sünden werden uns im Sakrament der Heiligen Beichte vergeben. Der Empfang des Heiligen Ölsakramentes ersetzt jedoch die Heilige Beichte nicht, sondern wir erhalten in diesem Sakrament die Vergebung unserer Sünden, darüber hinaus aber auch Heilung und Befreiung von allen jenen fatalen sündhaften Verkettungen und krankhaften Gebundenheiten, in die uns unsere sündhafter Lebenswandel am Ende geführt hat.
Gebet zur Spendung des Heiligen Ölsakramentes (Ölsalbung)
O heiliger Vater, Arzt der Seelen und Leiber, der Du Deinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, gesandt hast, dass Er alle Krankheit heile und uns vom Tode erlöse, heile deinen Diener N.N. von der ihn umfangenden leiblichen und geistlichen Schwäche und belebe ihn durch die Gnade deines Christus auf die Fürbitte unserer hochheiligen Herrin, der Gottesgebärerin und immerwährenden Jungfrau Maria und aller Heiligen. Denn Du bist die Quelle der Heilung, o Gott, unser Gott, und Dir senden wir empor Lob und Preis, dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Die Salbung in Bethanien am Großen und Heiligen Mittwoch
Die Szene der Salbung in Betanien wird uns durch die Evangelisten Markus (14: 3-9), Matthäus (26: 6-13) und Johannes (12: 1-8) erzählt. Es besteht ein Unterschied zwischen dem heiligen Johannes einerseits und dem heiligen Markus und heiligen Matthäus andererseits hinsichtlich der Identität der Personen, aber in der Grundlage bleibt der Bericht der gleiche: Markus und Matthäus verlegen die Szene in das Haus Simeons des Aussätzigen, während Johannes von einem Mahl bei Lazarus spricht, „den er von den Toten auferweckt hatte“. Während des Mahls nähert sich Christus eine Frau, die Markus und Matthäus nicht benennen, aber die Johannes Maria nennt, mit einem Gefäß mit sehr kostbarem Öl, mit dem sie die Füße Jesu salbt und dann mit ihrem Haar trocknet. Einige Jünger (nach Markus und Matthäus), Judas Iskariot (nach Johannes) drücken ihre Missbilligung angesichts einer solchen Verschwendung aus: „Warum hat man dieses Öl nicht für dreihundert Denare verkauft und den Erlös den Armen gegeben?“ entrüstet sich Judas. Johannes sagt uns, dass er sich in Wirklichkeit nicht für die Armen interessiert, sondern für sich selbst, da er der Schatzmeister der Gruppe war und an die Kasse wollte. Jesus antwortet ihm: „Lasst sie, damit sie es für den Tag meines Begräbnisses tue. Die Armen habt ihr immer bei euch, mich habt ihr nicht immer bei euch.“ Die Geste Marias nimmt die der Sünderin aus dem Lukas-Evangelium (7 : 36-38) wieder auf. Handelt es sich um die gleiche Person oder hat Maria, die Schwester des Lazarus, eigens diese Geste als Zeichen der Liebe und Anerkennung für den wiederholt, der ihrem Bruder das Leben wiedergegeben hat? Wie dem auch sei, die Kirche identifiziert, wenn sie am heiligen Mittwoch der Salbung in Betanien gedenkt, Maria mit der Sünderin und vielleicht auch mit Maria aus Magdala, der ersten Zeugin der Auferstehung, die einmal mehr Öl für Christus bringen wird, den sie im Grab zu finden glaubt. Die Texte der verschiedenen Gottesdienste dieses Tages stellen die reuige Liebe der Ölbringerin (auf griechisch myrrophore) dem Verrat des Judas entgegen. Denn während Maria, den nahen Tod Christi vorausahnend, ihm eine vorgezogene Ehrung erweist, entrüstet sich der unzufriedene Judas und stellt finstere Berechnungen an: Er hat Christus von Seinem Grab sprechen hören; er fühlt überhaupt keine Berufung zum Märtyrer, er hat zornig die dreihundert Denare, die in seiner Kasse hätten sein können, für Öl ausgeben sehen; er weiß, dass die Hohenpriester und Schriftgelehrten den Tod Jesu wollen und dass sie ein Mittel suchen, Seiner habhaft zu werden, ohne dass ein Aufruhr im Volk verursacht wird: „Darauf ging einer der Zwölf namens Judas Iskariot zu den Hohenpriestern und sagte: Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere? Und sie zahlten ihm dreißig Silberstücke. Von da an suchte er nach einer Gelegenheit, Ihn auszuliefern“ (Matthäus 26:14-19; Lukas 22: 3-6, Markus 14: 10-11). Auf diese Weise wird am Ende eine fatale Wahl getroffen, die Judas am Ende in den Selbstmord treiben wird. Schon sind die Rollen sind nach der Qualität eines jeden Herzens verteilt und die Stunde der Passion ist nahe herbei gekommen.
Zusammengestellt nach: Dieu est vivant. Catéchèse orthodoxe.